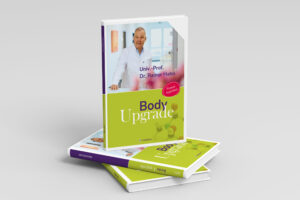Organspende in der Schweiz: Eine Entscheidung fürs Leben?
Organe spenden heisst Leben schenken. Doch die Entscheidung ist persönlich – und fordert Wissen, Haltung und Verantwortung.
In der Schweiz warten jedes Jahr über 1’400 Menschen auf ein lebensrettendes Organ. Gleichzeitig versterben viele von ihnen, weil keine passenden Spender gefunden werden. Ab 2025 tritt eine neue Regelung in Kraft: die erweiterte Widerspruchslösung. Wer keine Organe spenden möchte, muss dies künftig aktiv festhalten. Diese Änderung hat eine nationale Debatte ausgelöst – über Solidarität, Selbstbestimmung und Vertrauen in das System.
Aktueller Kontext: Die Widerspruchslösung ab 2025
Die Schweiz führt ab 2025 die erweiterte Widerspruchslösung ein. Das bedeutet: Alle Menschen gelten grundsätzlich als potenzielle Organspender – es sei denn, sie haben zu Lebzeiten widersprochen oder ihre Angehörigen lehnen eine Spende ab, weil kein Wille bekannt ist.
Bislang galt die Zustimmungslösung: Organspenden waren nur erlaubt, wenn die betroffene Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hatte oder die Angehörigen ihr Einverständnis gaben. Die Änderung soll die Zahl der Spender erhöhen und Leben retten.
Organspenden sind ausschliesslich bei eindeutig festgestelltem Hirntod möglich. Dieser wird nach streng medizinischen Kriterien diagnostiziert und erfordert die Bestätigung durch zwei unabhängige Fachärzte. Erst dann kann eine Entnahme in Betracht gezogen werden.
Pro Organspende – die Argumente
Die Gründe für eine positive Haltung zur Organspende sind vielfältig – medizinisch, ethisch und menschlich.
- Leben retten: Eine einzige Spende kann bis zu sieben Menschenleben retten – etwa durch Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse oder Darm.
- Solidarität: Wer selbst auf Hilfe hofft, sollte bereit sein, auch anderen zu helfen – ein Prinzip der Gegenseitigkeit in der Gesellschaft.
- Wunsch vieler Angehöriger: Zu wissen, dass aus dem Tod eines geliebten Menschen neues Leben entstehen kann, empfinden viele als tröstlich.
- Medizinische Sicherheit: Der Ablauf ist klar geregelt – von der Feststellung des Todes bis zur Begleitung durch Ethikkommissionen.
- Selbstbestimmung: Die Möglichkeit, den eigenen Willen frühzeitig festzuhalten, stärkt das individuelle Entscheidungsrecht.
In Umfragen befürworten rund 80 Prozent der Bevölkerung die Organspende – viele haben aber ihren Entscheid noch nicht dokumentiert.
Contra Organspende – die Bedenken
Trotz medizinischer Klarheit bestehen bei vielen Menschen Zweifel oder Ablehnung – aus persönlichen, ethischen oder weltanschaulichen Gründen.
- Hirntod-Debatte: Einige empfinden den Hirntod nicht als endgültig – sie sehen ihn nicht als tatsächliches Lebensende.
- Vertrauensfragen: Es besteht die Sorge, dass eine Organentnahme zu früh erfolgt oder wirtschaftliche Interessen überwiegen könnten.
- Religiöse und ethische Bedenken: Bestimmte Glaubensgemeinschaften oder spirituelle Überzeugungen lehnen Eingriffe nach dem Tod grundsätzlich ab.
- Widerspruchslösung: Die neue Regelung wirft Fragen nach Informationspflicht und Gerechtigkeit auf – besonders bei Menschen, die den Zugang zu Medien oder Formularen nicht haben.
- Belastung für Angehörige: Wenn kein dokumentierter Wille vorliegt, müssen die nächsten Verwandten entscheiden – eine schwierige Aufgabe in einer emotionalen Ausnahmesituation.
Diese Bedenken verdienen Gehör und Respekt – die Entscheidung für oder gegen eine Spende muss individuell getroffen und gesellschaftlich getragen werden.
Fazit: Bewusst entscheiden – mit Herz und Verstand
Organspende ist keine Pflicht, sondern ein Angebot. Sie berührt existenzielle Fragen nach Leben, Tod und Mitmenschlichkeit. Die neue gesetzliche Regelung in der Schweiz macht es umso wichtiger, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ob Ja oder Nein – entscheidend ist, dass man sich informiert, reflektiert und seine Haltung festhält. Damit schützt man nicht nur sich selbst, sondern entlastet auch Familie und Fachpersonen in schwierigen Momenten. Organspende kann ein Akt der Nächstenliebe sein – aber sie muss freiwillig, transparent und respektvoll bleiben.
Quelle: xund24.ch-Redaktion
Bildquellen: Bild 1: => Symbolbild © sweet_tomato/Shutterstock.com; Bild 2: => Symbolbild © Jacktamrong/Shutterstock.com